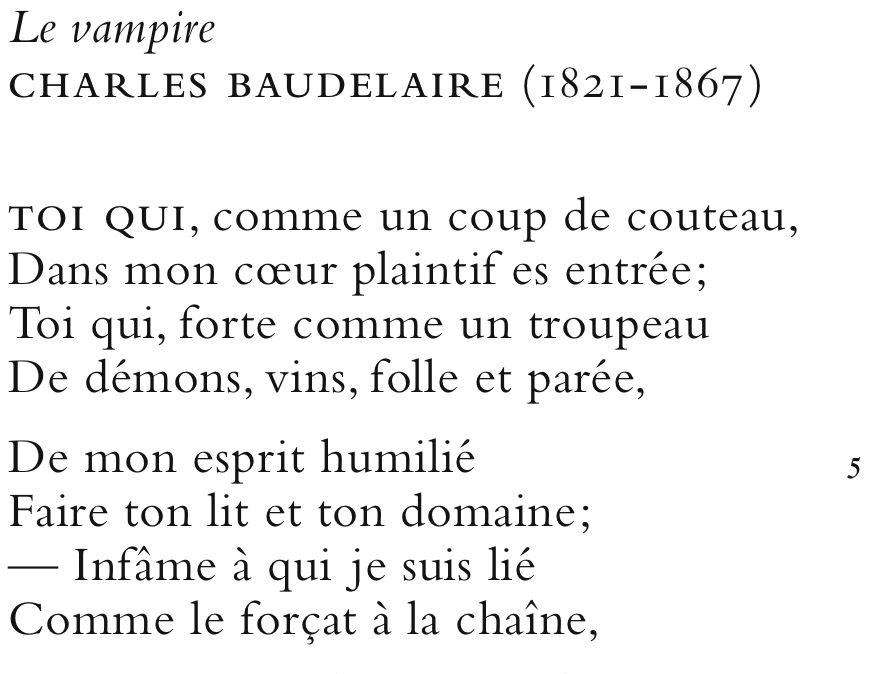Stolberg, Lied auf dem Wasser zu singen
Orșova, oder ein hilfloser Versuch über die Trostlosigkeit
Hilflos angesichts ihres Allumfassenden, ihres Ungemilderten, Zeitlosen – nichts kann vor ihr gewesen sein, nichts wird nach ihr kommen: Sie ist ein in unteilbarer Einheit verharrendes Ewiges, und leicht ließe sich sagen, man fühle sich hier, wollte man denn einem Hang zum Sarkasmus freien Lauf lassen, vom Hauch des Erhabenen gestreift. „Orșova, oder ein hilfloser Versuch über die Trostlosigkeit“ weiterlesen
Perspektive bei Walter De Maria – Teil 6
»…lines traveling out to infinite points…«
Beobachtungen zur Perspektive im Werk von Walter De Maria
Ein Essay in zehn Lieferungen
6.: Lightning Field und Mile-Long Parallel Walls in the Desert
„Perspektive bei Walter De Maria – Teil 6“ weiterlesen
Mircea Dinescu über Port Cetate
Meine erste Schleuse
Wider den Witz getrommelt und gepfiffen
Architektur als Zeitreise: Der denkwürdige Eklektizismus der Handelskammer in Mantua

„Architektur als Zeitreise: Der denkwürdige Eklektizismus der Handelskammer in Mantua“ weiterlesen
Brücken der Freundschaft
Perspektive bei Walter De Maria – Teil 5
Vor dem Hintergrund dieser Aussage fällt es nicht allzu schwer, dem bisher Gesagten zumindest eine gewisse Plausibilität zuzugestehen. Denn obwohl der Einspruch berechtigt ist, die perspektivischen Eigenheiten von Apollo’s Ecstasy seien ja ohne weiteres auch als unbeabsichtigte Folgen gänzlich anderer Intentionen zu erklären, läßt sich das Beharren des Künstlers auf die Vieldeutigkeit (ambiguity) und die Bedeutungsvielfalt ja als Hinweis darauf verstehen, daß in den auf denkbar einfache Elemente und Konstellationen reduzierten Kunstwerken eine überraschende Anzahl von Bedeutungsfacetten zu einem konsistenten Knoten geschürzt sei.

Baudelaire, Le vampire
Perspektive bei Walter De Maria – Teil 4
Ein Essay in zehn Lieferungen

Von den Schlössern der Zigeuner

Ob wohl die Zigeuner eine ähnlich romantische Vorstellung von festen Häusern haben mögen wie wir Seßhaften vom freien und kühnen Nomadenleben? — Die Wirklichkeit des fahrenden Volks sieht freilich wenig romantisch aus, wie wir wissen, und die trostlose Wirklichkeit der erzwungenen Seßhaftigkeit dürfte die Zigeuner zumindest in Rumänien rasch von jeglicher Romantik geheilt haben, sollte je die Gefahr einer solchen bestanden haben (für Goethe war sie ja von Anbeginn an eine Krankheit).
Vom Hängen-, Stecken-, Stehen-, Liegen- & Sitzenbleiben, oder ›Heimat, deine Sterne!‹
„Vom Hängen-, Stecken-, Stehen-, Liegen- & Sitzenbleiben, oder ›Heimat, deine Sterne!‹“ weiterlesen